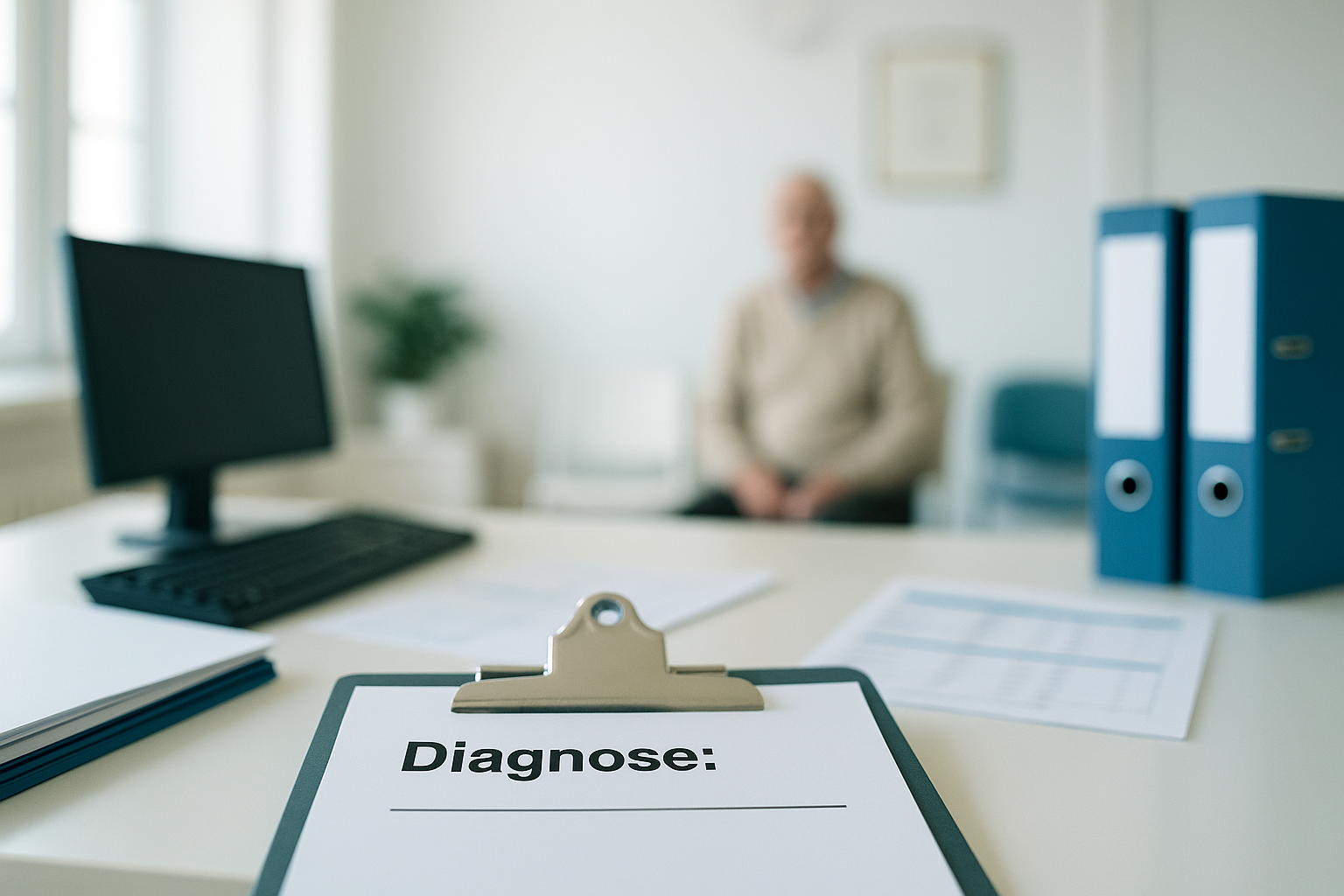Handgreiflichkeiten durch Menschen mit Demenz sind seltener als vielfach allgemein angenommen wird. Aber eben leider auch nicht so selten, dass sie kein immer wieder zu beachtendes Thema sind. Kommt es dazu, sind es für viele Pflegende sehr einschneidende Erlebnisse die je nach Situation großen Eindruck machen können. Manchmal ist ein solches Ereignis der Endpunkt der häuslichen Versorgung, manchmal ein Grund für Pflegende die Abteilung, die Einrichtung oder den Dienst, vielleicht sogar die Branche zu wechseln. Und für Menschen mit Demenz bedeutet ein solches Verhalten nicht selten, dass eine Kaskade von Maßnahmen in Gang gesetzt wird. Diese reicht von Dauer- oder Bedarfsmedikation bis zur Einweisung zur „medikamentösen Einstellung“, (vorläufiger) geschlossener Unterbringung oder auch täglicher Versorgung mit erhöhtem personellen Aufwand.
Aggression ist nicht grundlos
Zum Thema Aggression gibt es viel zu lesen und zu lernen. Alle möglichen Umstände und Aspekte – Personalmangel, Überforderung, nicht diagnostizierte psychische Erkrankungen und unerkannte Zustände die aggressives Verhalten hervorrufen oder zumindest beeinflussen können, spielen im Einzelfall eine Rolle. Sie können und sollen hier nicht beleuchtet werden. Vielmehr geht es darum, auch aus Selbstschutzgründen auf ein Problem aufmerksam zu machen. Das ist der Aufbau einer Barriere gegenüber Menschen mit Demenz mit dem eigenen Körper.
Männer in den Pflege-Kampf?
(Mir) ist wichtig, dass über Handgreiflichkeiten seitens Betroffener nicht einfach hinweggegangen wird in Pflegeteams. So, als seien sie „normal“. Pflegende haben selbstverständlich Recht und Anspruch darauf, im Rahmen ihrer Arbeit keine Gewalt zu erfahren – auch wenn das im Lauf der Berufsjahre praktisch unweigerlich vorkommen wird. Interessanterweise beobachte ich als Reaktion auf Aggressivität in Einrichtungen weniger ein fallanalytisches Vorgehen, denn das Phänomen, dass zu Menschen mit Demenz die aggressiv in Erscheinung getreten sind, besser „der Mann im Team“ gehen soll. Warum kann mir häufig nicht so richtig beantwortet werden von den Kolleginnen. Männer an die Front? Weil Männern es grundsätzlich weniger ausmacht, wenn sie geschlagen werden? Oder sie mehr Kraft haben – also den dementen alten Menschen dann im Kampf eher besiegen können? Die Begründungen sind manchmal amüsant, der Hintergrund ist und bleibt es jedoch nicht.
Umstände analysieren – davon profitieren alle Beteiligten
Wenn es zu einem Vorfall mit Handgreiflichkeiten kommt, lohnt es für Pflegeprofis immer zu untersuchen, wie es dazu kam. Häufig können Aspekte gefunden werden, die von A nach B geführt haben. Der „Angriff“ durch den Menschen mit Demenz ist häufig erklärbar, wenn versucht wurde sich in seine Rolle zu versetzen, sein Erleben nachzuvollziehen. Angst ist in meinen Augen ein Hauptgrund für Aggression bei Menschen mit Demenz. Das soll jedoch nicht nur Verständnis schaffen, sondern ganz alltags- und pflegepraktische Wirkung erzielen. Ein Problem ist auch hier der Zeit- und Mitarbeitermangel. Dann fallen wichtige Analysen weg, wichtige Absprachen zu gemeinschaftlichem Vorgehen, zur Ursachen- und Bedingungsanalyse und auch das gegenseitige kollegiale Auffangen nach einem solchen Vorfall.
- ambulant/zu Hause: in einer deutschlandweiten ZQP-Befragung pflegender Angehöriger berichteten 11 % körperliche und 45 % psychische Gewalt durch die gepflegte Person. ZQP – Häufigkeit von Gewalt (Zusammenfassung), ZQP-Analyse 2018 (PDF)
- pflegeheim/langzeitpflege: der BMG-Bericht zu „herausforderndem Verhalten“ nennt Prävalenzen körperlicher Aggression bei Menschen mit Demenz zwischen 31 % und 42 % (methodisch unterschiedliche Studien). BMG-Rahmenempfehlungen (PDF)
- akutkrankenhaus: die General Hospital Study (GHoSt) zeigt deutlich erhöhte Anteile von problematischem/agitiertem Verhalten bei Patientinnen und Patienten mit Demenz gegenüber Nicht-Demenz (Setting: Allgemeinkrankenhäuser in BW/BY). GHoSt-Abschlussbericht (PDF), Kurzinfo der Bosch-Stiftung
hinweis: messinstrumente und definitionen (z. b. „aggressiv“ vs. „agitiert“) sowie beobachtungszeiträume unterscheiden sich; prozente sind daher nicht 1:1 zwischen den settings vergleichbar.
Zwei Beispiele: „Stellungsfehler“ – (Flucht-)Wege offen lassen, statt blockieren
1. Stellen Sie sich vor, der alte Herr mit Demenz sucht den Ausgang. Dringend, er nimmt an, seine (längst verstorbene Frau) ist in Not. Er wird immer aufgebrachter, wie er so den Flur entlangläuft, er muss hier unbedingt raus, nach Hause. Er geht also so schnell er kann – und plötzlich steht jemand (die sorgende Person) direkt in seinem Weg und sagt: „Halt! Sie müssen hierbleiben.“. Ohne jetzt auf das Ansprechen einzugehen: wenn Sie sich die Szene vorstellen: sehen Sie den „Stellungsfehler“? Wenn Sie die Hürde auf dem Weg zum rettenden Ausgang sind und keinen Platz machen hilft am Ende nur, Sie beiseite zu schieben. Kräftig, wenn nötig. Ich vermeide es stets, mich aufgebrachten Menschen mit Demenz in den Weg zu stellen, solange das gefahrlos für ihn ist. Bleiben Sie an der Seite, lassen Sie Platz. Sie können sich im Notfall – z.B. um einen Sturz zu verhindern oder auch das Betreten einer vielbefahrenen Straße immer noch ungefragt unterhaken von der Seite. Aber, so lange es geht: machen Sie sich nicht selbst zur Barriere, die es zu überwinden gilt. Es besteht das Risiko, dass es zu einer Tätlichkeit kommt, weil Betroffene buchstäblich keinen anderen Weg (mehr) sehen.

2. Beispiel: ein Klassiker sind auch räumliche Bedingungen die nicht beachtet werden. Stellen Sie sich ein Badezimmer vor. Ein klassischer, kleiner Raum, womöglich ohne Fenster. Immer wieder möchte die alte Dame raus aus diesem Raum, in den sie gebracht wurde zur „Morgentoilette“. Sie geht hinaus, wird wieder hineingeführt, geht hinaus, wird wieder hineingeführt. Selbstverständlich immer mit der begleitenden Belehrung, dass sie jetzt gewaschen werden müsse oder etwas in der Art. Da sie wieder drauf und dran ist das Bad zu verlassen, stellt sich die Pflegeperson direkt in den Türrahmen. Damit ist der Ausweg zu. Die einzige Fluchtmöglichkeit für die alte Dame ist jetzt versperrt. Was soll sie, was kann sie noch tun um zu fliehen?
Beide Beispiele zeigen, dass es für Pflegende nicht nur wichtig ist zu verstehen wie Sie sich bewegen oder stellen sollen bei einer aufgebrachten Person mit Demenz. Beide Situationen zeigen auch, dass eine Fallbesprechung im Anschluss die höhere Chance bietet, derlei „Fehler“ zu entdecken und sich entsprechend anders zu verhalten.
Keine Frage von Schuld
Diese beiden kurzen Beispiele sollen eigentlich nur eines zeigen: Tätlichkeiten kommen in der Regel nicht aus „dem Nichts“. Vielmehr verpassen wir zu oft den Punkt an dem wir die Spannung herausnehmen müssen, ein Vorhaben abbrechen, eine Situation neu initiieren sollten. Häufig ist viel zuviel Druck in der Pflege – und der überträgt sich auch auf Menschen mit Demenz. Was genau passiert eigentlich Schlimmes, wenn die Dame im 2. Beispiel heute nicht gewaschen wird? Es geht nicht darum, Fehler festzustellen. Es geht darum, Auslöser, Trigger zu vermeiden die eine Situation zum handgreiflichen Konflikt werden lässt.
Dabei geht es um derartig viele, auch ganz individuelle Punkte, dass sich das genaue Hinsehen für alle Beteiligten lohnt. Menschen mit Demenz sind per se keine besonders aggressive Personengruppe. Sie haben aber viel weniger Möglichkeiten, der Pflege auszuweichen. Sie können sich und ihre Emotionen und Handlungen schlechter regulieren und sich mit dem Krankheitsfortschritt auch immer schlechter verständlich machen. Das ist kein Freibrief für Handgreiflichkeiten durch Menschen mit Demenz. Es ist ein Zugeständnis, dass Pflege meist viel mächtiger ist eine Situation zu beeinflussen, als die Person mit Demenz. Suchen wir also nicht nach Schuldigen im Team, sondern suchen wir ganz bewusst nach Möglichkeiten unsere Arbeit so zu gestalten, dass wir nicht die Hürden sind. Beziehen wir – buchstäblich – kluge Positionen. Eine sinnvolle Analyse wie es zu einer Handgreiflichkeit kam wird übrigens durch schlechte Dokumentation erschwert: oder was lässt sich aus dem Eintrag „ist unmotiviert aggressiv“ für eine Verbesserung der Situation schließen? Eine Fallbesprechung sollte sich an einen Vorfall stets anschließen. Aggressionserfahrene Kolleginnen und Kollegen müssen zudem darauf achten, wie und ob ein solches Ereignis Dritte belastet und ggfs. Unterstützung bei der Verarbeitung anbieten.
Jochen Gust
Amazon-Affiliate-Link: Fragen zu nächtlicher Unruhe oder zu Schreien und Rufen? Hier finden Sie Infos.