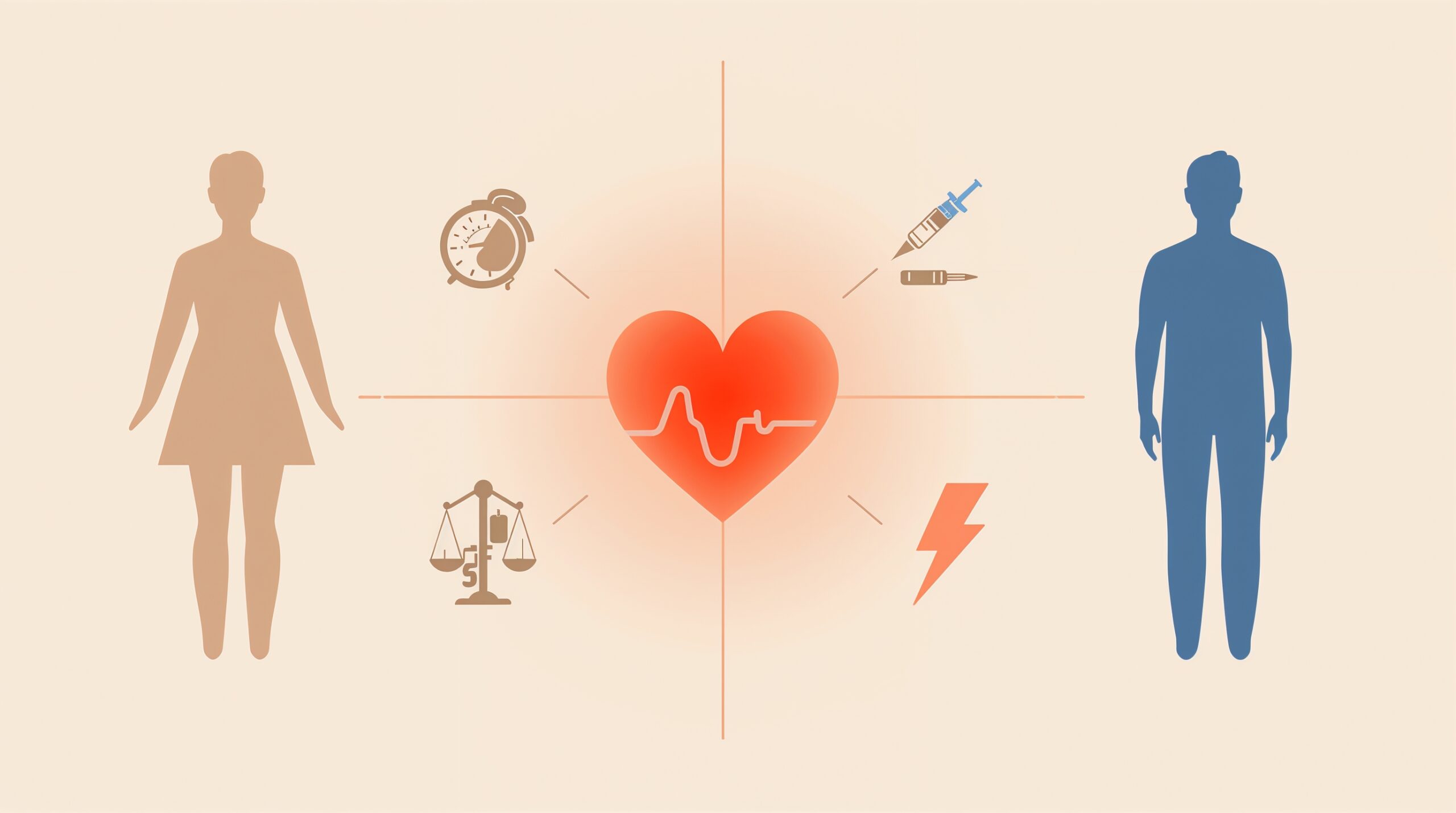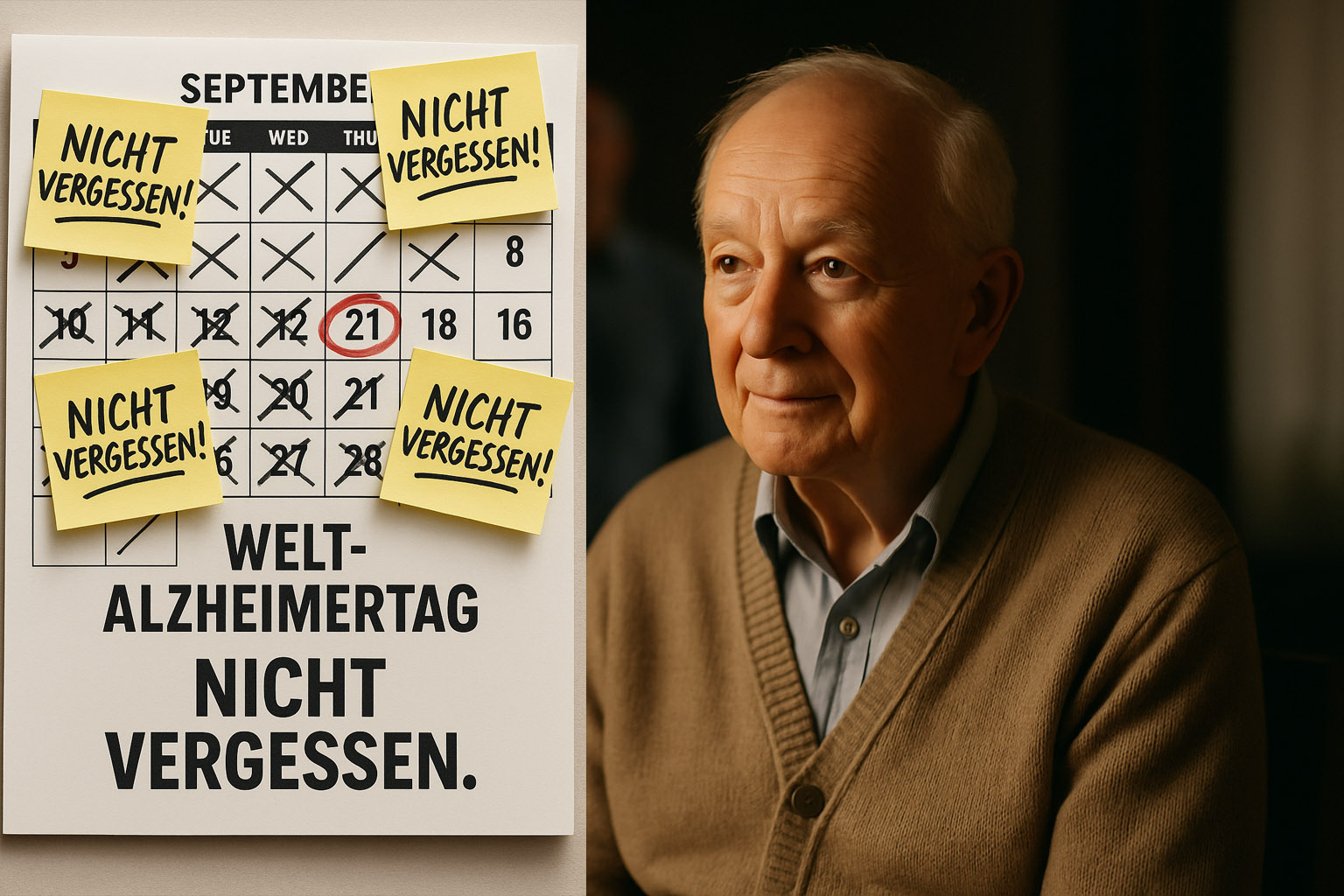Das Delir gehört zu den häufigsten akuten Komplikationen bei älteren Patientinnen und Patienten im Krankenhaus – und es ist zugleich eine der am meisten unterschätzten. Für Pflegefachpersonen ist das Thema hochrelevant, weil die Folgen gravierend sind: längere Liegezeiten (Verweildauer), erhöhte Komplikationsraten, bleibender kognitiver Abbau und Folgen für die Selbstversorgungsfähigkeit sowie ein deutlich erhöhtes Sterberisiko. Besonders gefährdet sind Menschen mit einer bereits bestehenden Demenz. Für sie bedeutet ein Krankenhausaufenthalt oft nicht nur eine anlassbedingte medizinische Herausforderung, sondern einen radikalen Bruch mit ihrer vertrauten Welt. Vertraute Routinen, bekannte Gesichter und Orientierungspunkte brechen plötzlich weg. Das Gehirn reagiert darauf mit einer akuten Entgleisung: einem Delir.
Delirante Zustände sind Krankenhausalltag
Ein erheblicher Teil dieser Patientengruppe kommt bereits mit einem Delir ins Krankenhaus. Schätzungen sprechen von etwa einem Drittel aller demenzkranken Patientinnen und Patienten, die schon bei der Aufnahme delirant sind. Das bedeutet, dass Pflegefachpersonen im Krankenhaus es bei fast jedem zweiten Menschen mit Demenz mit einem Delir zu tun haben – entweder bei der Aufnahme oder im weiteren Verlauf. In Summe zeigt sich bei etwa der Hälfte der Menschen mit Demenz im Krankenhaus ein Delir: ca. 20 % bereits bei Aufnahme, weitere rund 30 % im Verlauf. In der klinischen Praxis sind Menschen mit Demenz und Delir also keine Ausnahme, sondern Alltag.
Delir als „Stressfolge“? Das Krankenhaus ist ideal dafür
Warum triggert gerade das Krankenhausumfeld akute Verwirrtheit so stark? Um das zu verstehen, lohnt sich ein Blick ins Gehirn. Bei Menschen mit Demenz sind bereits zentrale Strukturen für Gedächtnis, Orientierung und Aufmerksamkeit geschädigt. Der Botenstoff Acetylcholin, der für die Steuerung dieser Funktionen eine entscheidende Rolle spielt, ist im Mangel. Schon im stabilen häuslichen Umfeld bedeutet dies eine verringerte Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen. Kommt es dann zu einem abrupten Umgebungswechsel – fremde Zimmer, grelles Licht, ständige Geräusche, wechselndes Personal – wird das fragile Gleichgewicht empfindlich gestört. Dabei kommt es in keiner Weise darauf an, ob der Krankenhausaufenthalt bzw. der Umgebungswechsel lange geplant oder angekündigt war, sondern allein auf das Erleben des Menschen mit Demenz, für den die Situation neu ist: das Gehirn kann die Flut neuer Eindrücke nicht mehr sortieren, und „kippt“ in der Folge in ein Delir.
Delir bei Demenz im Krankenhaus: Wann tritt es auf?
Beispielhafte Verteilung nach Studienlage: etwa die Hälfte entwickelt ein Delir.
- Schon bei Aufnahme mit Delir (20 %)
- Entwickeln Delir während des Aufenthalts (30 %)
- Kein Delir im gesamten Verlauf (50 %)
Eine zentrale Rolle spielt dabei das Ungleichgewicht der Neurotransmitter. Während Acetylcholin fehlt, steigt gleichzeitig die Aktivität des Botenstoffes Dopamin. Das führt zu Halluzinationen, motorischer Unruhe und Wahnideen – typische Symptome, die Pflegefachpersonen im Krankenhausalltag sofort erkennen. Hinzu kommen die körperlichen Belastungen, die fast jeder stationäre Aufenthalt mit sich bringt: Operationen, Infekte, Flüssigkeitsmangel oder Medikamente, die selbst delirfördernd wirken können. Für ein Gehirn, das durch die Demenz bereits vorgeschädigt ist, entsteht so eine Art „perfect storm“ – die Kombination mehrerer Risikofaktoren, die unmittelbar ins Delir münden. Auch Stresshormone verstärken diesen Prozess. Ein Krankenhausaufenthalt bedeutet für viele Menschen mit Demenz eine massive Stressreaktion. Der Hypothalamus aktiviert die Hormonachse, Cortisol wird ausgeschüttet. In einem gesunden Gehirn wird dieser Mechanismus irgendwann wieder herunterreguliert. Bei Demenz gelingt das nicht mehr ausreichend.
Schwierig für die Pflege: die Delir-Dynamik
Pflegefachpersonen kennen die Symptome aus dem Alltag: Plötzlich wirkt ein Patient stark verlangsamt, zieht sich zurück, isst und trinkt kaum noch – oder er wird auffallend unruhig, versucht aufzustehen, zupft an den Infusionsschläuchen oder ruft laut nach Angehörigen. Nicht selten wechseln sich diese Phasen innerhalb von Stunden ab. Ein Delir ist dynamisch, es verändert sich, und gerade deshalb ist es so schwer zu greifen. Die Herausforderung im Krankenhaus: Ein Delir wird oft übersehen oder für „normale“ Verhaltensauffälligkeit bei Demenz gehalten. Dabei handelt es sich um eine eigenständige, potenziell lebensgefährliche Komplikation.
Konsequente Delir-Arbeit ist das Gebot
Für die Praxis ist klar: das Risiko eines Delirs ist bei Demenz nicht nur erhöht – es ist nahezu erwartbar. Delirprävention beginnt schon bei der Aufnahme. Eine sorgfältige Anamnese, die Einbeziehung von Angehörigen so weit möglich, Orientierungshilfen – von einer Uhr im Blickfeld bis zu vertrauten Gegenständen am Bett – sind einfache, aber wirksame Maßnahmen. Ebenso entscheidend ist eine ruhige, klare Kommunikation, die sich an den Möglichkeiten der Betroffenen orientiert. Auch die enge Zusammenarbeit im interdisziplinären Team ist essenziell: Nur wenn Pflege, Medizin und Angehörige an einem Strang ziehen, lässt sich das Delirrisiko spürbar senken.
Jochen Gust